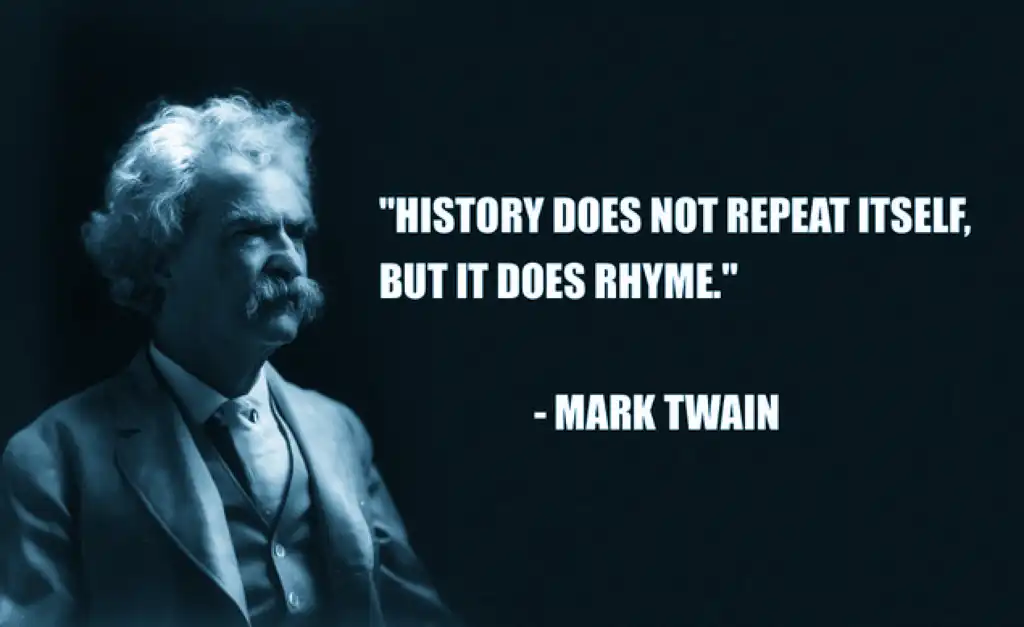Das Ahrtal 1910 - 2021
Das Ahrtal: Als die Geschichte sich reimte – Von Kanonenbahn, Katastrophen und geheimen Bunkern
Eine packende Chronik über 111 Jahre Schicksal, Ingenieurskunst und menschliche Widerstandskraft
Dieter Feige, September 2021
„Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich“, so Mark Twain. Kaum ein Ort in Deutschland demonstriert diese Weisheit eindringlicher als das Ahrtal. Als im Juli 2021 die verheerende Flut das Tal verwüstete, wurde die Welt Zeuge einer Katastrophe, die sich fast auf den Tag genau 111 Jahre nach einem ähnlichen, doch weitgehend vergessenen Jahrhunderthochwasser von 1910 ereignete. Damals kostete es 52 Menschen, darunter viele osteuropäische Bahnbauarbeiter, das Leben und legte das Ahrtal in nur acht Stunden über 37 Stromkilometer in Schutt und Asche.
Doch das verheerende Hochwasser von 1910 markiert nur einen von drei Wendepunkten, die das wohl kühnste Projekt der deutschen Eisenbahngeschichte letztlich scheitern ließen: den Bau der legendären „Ruhr-Mosel-Entlastungslinie“. Diese Geschichte einer unvollendeten Bahnstrecke offenbart nicht nur militärstrategische Visionen, sondern auch die erstaunliche Wiederverwendung ihrer Infrastruktur – insbesondere der Tunnel – im Laufe der wechselvollen Historie. Tauchen wir ein in diese bewegenden Ereignisse.
1904: Kriegsvorbereitungen und die "Kanonenbahn"
Nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 fielen Elsass und Lothringen mit ihren Eisenerzvorkommen an das Deutsche Kaiserreich. Um diese wichtige Industrieregion mit dem 500 Kilometer entfernten Steinkohlerevier Ruhrgebiet zu verbinden, war eine neue Strecke unerlässlich. Die „Ruhr-Mosel-Entlastungslinie“ sollte zweigleisig von Neuss über Liblar (heute: Erftstadt) und weiter durch das Ahrtal bis Trier führen.
Doch es gab einen zweiten, triftigeren Grund: der preußische Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen, der weitsichtig einen Zweifrontenkrieg mit Frankreich und Russland kommen sah, plante diese Trasse auch für den schnellen Transport kriegsrelevanter Güter und Truppen an die französische Grenze. Daher ihr Spitzname: Kanonenbahn.
Seit 1904 wurde die Ahrtalbahn, Teil eines Netzwerks von vier strategisch wichtigen Entlastungsstrecken, nach dem Schlieffen-Plan militärisch ertüchtigt. Der Bau stellte enorme technische Anforderungen: Steigungen mussten auf 1 Prozent begrenzt und Kurvenradien von 300 Metern ausgelegt werden, was den Bau zahlreicher Tunnel und Brücken erforderte. Eingeplant war indes keine Naturkatastrophe: Das furchtbare Ahrhochwasser 1910 zerstörte Baugerüste, Baracken und Brücken, riss Baumaterialien mit sich und legte das ehrgeizige Vorhaben vorerst lahm.
1923: Der Baustopp und die Bremse der Innovation
Der Erste Weltkrieg und die politischen Folgen der Niederlage läuteten den zweiten Wendepunkt ein. Elsass-Lothringen war verloren, und das wirtschaftlich geschwächte Ruhrgebiet stand ab 1923 unter französischer Militärverwaltung, die für die „Ruhr-Mosel-Entlastungslinie“ sofort einen sechsjährigen Baustopp verhängte. Die Arbeiten kamen nur noch schleppend voran. Rund 15 Jahre lag das Vorhaben mehr oder weniger brach.
Der dritte und entscheidende Wendepunkt war die Erfindung der „Kunze-Knorr-Bremse“. Diese neuartige Druckluftbremse, ab 1915 in Betrieb genommen und kontinuierlich optimiert, machte die teure „Ruhr-Mosel-Entlastungslinie“ in ihrer ursprünglichen Form unrentabel. Durch die merklich verbesserte Bremstechnik konnte die Höchstgeschwindigkeit von Güterzügen von 30 auf 65 km/h gesteigert werden. Die kürzere Strecke der geplanten Entlastungslinie konnte das mehr als doppelte Tempo auf dem bestehenden Gleisnetz entlang der Rheinschiene nicht mehr ausgleichen. Die „Kunze-Knorr-Bremse“ hatte den Schlieffen-Plan endgültig ausgebremst.
Buchstäblich auf der Strecke zurück blieben die fertiggestellten Silberbergtunnel (650 m), Kuxbergtunnel (1,3 km), Trotzenberg-, Sonderberg- sowie Herrenbergtunnel wie auch die imposanten Brückenpfeiler des Viadukts nördlich von Ahrweiler, die heute, „Schwurfinger“ genannt, als Kletterpark genutzt werden. Ab 1933 fanden einige ungenutzte Tunnelanlagen sogar eine friedlichere Bestimmung: den Anbau von Edel-Champignons.
1944: Vom Bunker zur Wunderwaffenschmiede und "Stadt im Berg"
Im Kriegsjahr 1944 wurden die ehemaligen Eisenbahntunnel als geheime Filiale der Versuchsanstalt Peenemünde für die „Wunderwaffen“ V1 und V2 genutzt. Unter den Decknamen „Spatz“ und „Rebstock“ war geplant, in den vor Luftangriffen geschützten Tunnelanlagen V1-Teile und mobile Abschussrampen der V2 zu fertigen. Die Herstellung der Bodenanlagen in „Rebstock“ wurde im Silberberg- und Kuxbergtunnel von September bis Dezember 1944 von Zwangsarbeitern, darunter 300 jüdische Häftlinge aus dem KZ Buchenwald, durchgeführt. Unmenschliche Zustände, Mangelernährung und Terror führten zu zahlreichen Todesfällen, die offiziell nicht dokumentiert sind.
Wegen der Nachschubstrecke für die Westfront und des Vorstoßes der Alliierten wurde das Ahrtal von Mitte 1944 bis März 1945 zum Ziel von 52 Flächenbombardierungen. Zum Schutz der Einwohner von Ahrweiler wurde ab November 1944 in Windeseile im Silberbergtunnel eine „Stadt im Berg“ errichtet, die zuletzt rund 2.550 Menschen, also achtzig Prozent der Bevölkerung, tagsüber als Zufluchtsstätte diente. In bis zu 305 primitiven Holzbehausungen, liebevoll „Büdchen“ genannt, die beidseitig eines Durchgangs (der „Adolf-Hitler-Allee“ genannt wurde) aufgestellt waren, überlebten die Menschen fünf Monate des Terrors. Eine museal eingerichtete Gedenkstätte erinnert heute an diesen einmaligen Luftschutzbunker von Ahrweiler, der 1947 von den Franzosen gesprengt wurde.
1961: Die geheime Kommandosache Regierungsbunker
Mitte der 1950er-Jahre, inmitten des Kalten Kriegs, plante die junge Bundesrepublik Deutschland unter strengster Geheimhaltung einen „Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes (AdVB)“ – kurz: einen Regierungsbunker. Als NATO-Partner war die BRD verpflichtet, eine permanente Befehlsstelle für den Krisen- und Verteidigungsfall vorzuhalten. Die Wahl fiel auf den Kuxbergtunnel und den Trotzenbergtunnel. Unter dem Tarnnamen „Ausbau Anlagen THW“ begann der Ausbau. Die Anlage, die 3.000 Amtsträger für rund 30 Tage beherbergen sollte, war mit rund 7,2 Mrd. Euro das teuerste Bauwerk der bundesrepublikanischen Geschichte. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Wahl Berlins als Bundeshauptstadt wurde der Bunker 1997 aufgegeben. Heute erinnert die Dokumentationsstätte Regierungsbunker an dieses faszinierende Kapitel deutscher Geschichte und zieht zahlreiche Besucher aus aller Welt an.
2021: Ein Rückblick mit Aussicht – Die Ahr im Wandel
Geschichte reimt sich. Die Chroniken seit dem 14. Jahrhundert belegen viele schwere Überflutungen im Ahrtal; vor 1910 war es 1804 ebenfalls ein Jahrhunderthochwasser mit sogar höheren Pegelständen. Die geografische Lage – steile Hänge, viele Nebenflüsse und ein starkes Gefälle der Ahr – macht das Tal anfällig für solche Ereignisse. „Zu nahe am Wasser gebaut“ trifft für die Menschen an der Ahr leider doppelt zu.
Die letzte Jahrhundertflut 2021 hat die Ahrtalbahn arg in Mitleidenschaft gezogen. Während Teile wieder befahrbar sein sollen, werden der Neubau mehrerer Brücken und die Neutrassierung der Gleisverläufe Jahre dauern. Die Bahn bleibt für diese Region, ihre heimatverbundenen Bewohner, die Wirtschaft und den Tourismus ein wichtigstes Verkehrsmittel. Da ohne Alternative, lohnt sich die Instandsetzung als Zukunftsertüchtigung, denn für kommende Hochwasser sind effiziente Schutzmaßnahmen geplant. Eine Schicksalsentscheidung jedoch, so es schon der römische Stoiker Epiktet (1. Jhdt.) vermerkte: „Ruin und Wiederaufbau liegen dicht beieinander.“ Das Ahrtal ist ein lebendiges Beispiel für Resilienz und den unermüdlichen Kampf des Menschen gegen die Naturgewalten.
Welche weiteren "Reime der Geschichte" sehen Sie in der Entwicklung von Infrastrukturprojekten oder der Reaktion auf Katastrophen? Ich freue mich auf Ihre Gedanken!
Ihr Dieter Feige